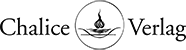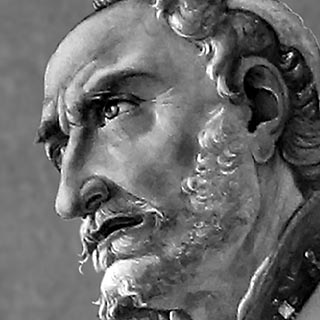
Sandro Botticelli (um 1480): »Sankt Augustin in seiner Zelle« (Ausschnitt)
Aurelius Augustinus
Von Ladislaus Boros
Aurelius Augustinus (354–430) war einer der größten Denker des Christentums. Für mich ist er kein Wesen besonderer Art oder von fremder Beschaffenheit. Er hat das Menschliche in seinen irdischsten Formen gekannt. Aber Elend, Schwächen, Zweifel und Ängste vermochten sein glühendes Forschen nach Gott nicht aufzuhalten. Überall suchte er Gott. Sein langer Irrweg hat sich durch alle Bahnen gezogen, über alle Pfade, alle Straßen, alle kleinen, abwegigen Gassen unserer Existenz. Sein Dasein mit seinen dramatischen Umbrüchen, Verirrungen und Aufstiegen war ein von Gott gemeisterter Stoff. Ich möchte jetzt die Einzelheiten seines Lebens nicht nacherzählen. Sie lassen sich leicht nachlesen. Auch möchte ich auf seine reichhaltige Theologie nicht näher eingehen, sondern nur eine einzige Aussage von ihm darstellen, in welcher sich seine Suche nach Gott verdichtete.
In seinen berühmten Bekenntnissen schrieb er im Jahr 397:
Was aber liebe ich, wenn ich Dich liebe, mein Gott? Nicht die Schönheit eines Körpers noch den Rhythmus der bewegten Zeit. Nicht den Glanz des Lichtes, der da so lieb ist in den Augen. Nicht die süßen Melodien in der Welt des Tönens aller Art. Nicht der Blumen, Salben, Spezereien Wohlgeruch. Nicht Manna und nicht Honig. Nicht Liebesglieder, die so köstlich sind in der leiblichen Umarmung. Nichts von dem liebe ich, wenn ich liebe meinen Gott. Und dennoch liebe ich ein Licht und einen Klang und einen Duft und eine Speise und eine Umarmung meines inneren Menschen. Dort erstrahlt meiner Seele, was kein Raum erfasst. Dort erklingt, was keine Zeit entführt. Dort duftet, was kein Wind verweht. Dort mundet, was keine Sattheit je vergällt. Dort schmiegt sich an, was kein Überdruss auseinanderlöst. Das ist es, was ich liebe, wenn ich liebe meinen Gott.
In unerhörter Dichte entwirft Augustinus die »Gotteserfahrung durch die geschöpfliche Welt«. Ja, ich möchte sogar sagen, die Gotteserfahrung der Sinne. Damit griff er auf eine ältere Tradition zurück. Bereits Origenes sagte: »Die Propheten entdeckten die göttliche Sinnlichkeit. Sie schauten auf eine göttliche Weise und hörten auf eine göttliche Art. Und sie schmeckten und verspürten vermittels einer, wenn ich so sagen darf, unsinnlichen Sinnlichkeit und tasteten das Wort durch den Glauben an.« Ich bin überzeugt davon, dass diese Art der Gotteserfahrung durchaus berechtigt und vielleicht für viele Menschen von heute der einzige Weg zu Gott ist.
So mag zum Beispiel in der sinnlichen Erfahrung der Natur für uns Menschen eine unsichtbare Schönheit aufleuchten. Im leisen Wehen des Frühlings, in den schwellenden Knospen und im überströmenden Blühen mag der Mensch etwas erfahren, das eigentlich in der Tiefe des Lenzrausches jubelt: Gott, Der jünger ist als alles Junge, neuer als alles Neue. In der gesättigten Fülle des Sommers, im schweren Duft des Reifens der Frucht mag jemand die Ewigkeitsfrucht erahnen, die nie vergeht. In der kühlen Einsamkeit des Herbstes mag der Mensch Gottes kühle Geisteinsamkeit erspüren, die alles Werden und Vergehen überlebt. Und in der Stille des Winters, da sich das Leben unter der weißen Schneedecke verschweigt, mag er eine Botschaft von einem Gott unergründlichen Schweigens wahrnehmen.
Aber auch im eigenen Leben kann der suchende Mensch Gott erspüren. Vor allem im zeitlichen Nachvollzug seines Daseins. Im Leben des Kindes zeigt sich der lächelnde Märchengott, der gütige Weihnachtsgott oder auch der Gott mit dem langen, weißen Bart. In der Reifezeit erspürt der Mensch den Gott der Unruhe, den rätselhaften Gott, den Gott des brennenden Stachels, der immer nur vorwärtstreibt. Im Berufsleben erahnt der Mensch den Gott der ewigstillen Kraft, das Antlitz der Unendlichkeit, die ihn seine Begrenztheit spüren lässt. Der Gott des Alters ist ein Gott der lächelnden Gelassenheit.
Auch in der Liebe zwischen Mann und Frau wird Gott erspürt. Gott selbst leuchtet auf in der Tiefe der Liebe. Er ist das Heiligste, das der Mann in der Frau verehrt. Gottes Zartheit der Liebe schwingt in der fraulichen Feinheit des Ahnens und Erratens und Verstehens, Gottes Mütterlichkeit in der Mütterlichkeit der Frau. Wiederum aber, wie das Erhabenste, was die Frau im Manne sucht, gerade Gott ist, so auch Gottes schützende Kraft, Gottes klare Bewusstheit, Gottes Entscheidungskraft.
Auch in der Kunst kann der Mensch Gott erahnen. In der Plastik und Malerei, in der Dichtung mag einen Menschen das letzte Wort ansprechen, die letzte, unsagbare Wehmut der Menschenseele. Was zum Beispiel unser Dasein so heiter und leicht machen kann, wenn wir Mozarts klare Rhythmen hören, ist wohl das Verspüren dessen, was die Alten die »ewig alte und ewig neue Schönheit«, »Gott«, genannt haben.
Freilich ist der konkrete Anlass dieser Erfahrung nicht unser Gott. Er ist aber die Umschlagstelle des Irdischen zu Gott. Gott ist notwendig in allen Dingen als ihr Innerstes, gerade weil Er über allen Dingen steht. Es ist eine unvollkommene, ich möchte sogar sagen, falsche Darstellung, wenn man Gott als die Spitze der Welt denkt. Gott ist nicht »Vollendung der Geschöpfe«, sondern steht grundsätzlich außerhalb der Welt. Außerhalb sowohl der Materie wie auch außerhalb des Geistes. Gerade deshalb vermag Er aber, allen Wesen nahe zu sein. Er kann uns Sein Innerstes durch sie aufleuchten lassen.
Etwas sehr Wichtiges können wir von Aurelius Augustinus lernen: kein Geschöpf, keine Schwester, keinen Bruder, keine weltliche Schönheit und keine irdische Erfahrung geringzuachten, weil Gott uns in ihnen unter hundert und tausend Gestalten entgegenkommt und aus ihnen für uns ewige Geschenke wirkt, da Er selber in ihnen das Geschenk ist. Vor allem gilt dies von jenem Gott, Der von Sich sagte, dass Er die Liebe selbst sei. »Die Liebe ist das Urgeschenk. Alles, was uns sonst noch unverdient gegeben werden mag, wird erst durch sie zum Geschenk.«
Aus Ladislaus Boros: Im Leben Gott erfahren, enthalten in Gesamtausgabe, Band 5, Seiten 240–242.